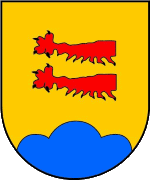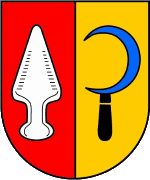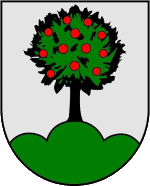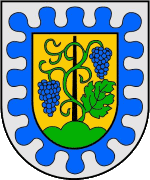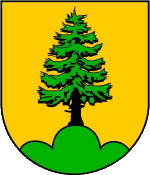In Gold über einem blauen Dreiberg zwei rechtshinliegende, schwarzbewehrte rote Löwenpranken übereinander.
Binningen bildete mit Hofwiesen und Storzeln eine Besitzung der zur Reichsritterschaft Hegau zählenden Familie von Hornstein. Infolge des zwischen Baden und Württemberg am 13. November 1806 abgeschlossenen Vertrags kam Binningen an Württemberg und wurde 1810 tauschweise dem Großherzogtum Baden überlassen. 1810/1811 gehörte Binningen zum Amt Blumenfeld, die folgenden beiden Jahre zählte die Gemeinde zum Amt Stockach. Seit 1813 gehörte Binningen zum Amt Blumenfeld, nach dessen Aufhebung 1857 bis 1936 zum Amt Engen. Seit 1936 zählt Binningen zum Amtsbezirk bzw. Landkreis Konstanz. Während der württembergischen Zeit wurde die Gemeinde Hofwiesen mit Binningen vereinigt. Die durch die Einwohner zwischen 1816 und 1845 mehrfach vorgetragene Bitte „um Wiedererhaltung eigener Communalexistenz“ wurde vom Ministerium des Innern stets abschlägig beschieden. Ein Bürger von Hofwiesen besorgte bis zur allgemeinen Aufhebung der abgesonderten Gemarkungen als „Stabhalter“ die Ortspolizei in der „Abgesonderten Gemarkung Hofwiesen“. Die Gemarkung Hohenstoffeln wurde auf 01. Oktober 1924 mit der Gemeinde Binningen vereinigt. 1540 besiegeln der Obervogt der Herrschaft Hewen, Peter Andreas von Altendorf zu Neuhausen und der Alt-Stadtammann Laux Jaeck, Obervogt zu Hohenkrähen, für die Gemeinde Binningen den zwischen Bilgerin von Reischach, den Brüdern Jakob und Pankraz von Stoffeln und den Untertanen zu Weiterdingen und Binningen wegen der Gerichtsbarkeit in diesen beiden Orten abgeschlossenen Vergleich. 1575 fertigt der Vogt Hans Sailer zu Binningen eine Gültverschreibung aus, auf seine Bitte hängt Jakob von Stoffeln sein Siegel der Urkunde an. Ein 1651 von Gorius Meyer und Veit Sayler zu Binningen für das Kloster St. Gallen ausgestellter Revers wird auf deren Bitte von Johannes Sax, Obervogt der Herrschaft Hohenstoffeln, besiegelt.
Die Huldigung der Binninger Bürger von 1811 wurde durch das Bezirksamt beglaubigt, da die Gemeinde über kein eigenes Siegel verfügte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verwendete die Gemeinde einen ovalen Farbstempel mit dem Schriftzug Bürgermeisteramt Binningen.
Auf Vorschlag des Generallandesarchivs nahm der Gemeinderat im Dezember 1901 folgendes Wappen an: In Silber drei rote Bärentatzen übereinander. Die Bärentatzen wurden – allerdings in einer falschen Deutung – dem Wappen der Herren von Stoffeln, einstmals Herren von Binningen, entnommen. Noch im Dezember stach der Goldarbeiter Wagenseil in Engen für die Gemeinde ein Siegel mit dem neuen Wappen. Auch der im November 1903 f+r die abgesonderte Gemarkung Hofwiesen beschaffte Stempel zeigt dieses Wappen. Die Umschrift lautet Abgesonderte Gemarkung Hofwiesen - Der Stabhalter -.
1921 wünschte die Gemeinde Binningen eine Änderung des Wappens. Als eine dem „Landschafts- oder Betriebsbild der Gemeinde“ entsprechende Darstellung zeigte das Wappen in Blau auf grünem Boden über blauem Wasser einen Storch in natürlicher Farbe, eine Natter im Schnabel haltend.
Der Gemeinderat nahm im Dezember 1921 dieses auf die Landschaft um den binninger See weisende Wappen an; im März 1922 lieferte der Graveur Arnold in Freiburg die neuen Stempel.
Anlässlich der 1958 vorgenommenen Prüfung der Siegel und Wappen aller Gemeinden des Landkreises Konstanz durch das Generallandesarchiv und einer notwendigen Erneuerung des Siegelstempels wurde in der Gemeinde der Wunsch laut, das heraldisch nicht sehr gelungene Wappenbild von 1922 wieder abzuschaffen. Auf das alte Wappen von 1901 wollte man nicht zurückkommen. Nach Verhandlungen mit dem Generallandesarchiv wurde schließlich das oben abgebildete Wappen gewählt. Es ist eine Kombination von Symbolen aus den Wappne der Herren von Stoffeln und der Familie von Hornstein. In richtiger Deutung des Stoffelschen Wappens wurden jetzt nicht Bärentatzen, sondern Löwenpranken gezeichnet. Dem Hornsteinschen Wappen wurde der Dreiberg entnommen. Aus heraldischen Gründen sind die Farben des Hornsteinschen Wappens vertauscht worden.
In gespaltenem Schild vorne in Rot eine gestürzte silberne Pflugschar, hinten in Gold eine blaue Sichel mit schwarzem Griff.
Duchtlingen mit Hohenkrähen war seit 1758 eine Besitzung der zum Ritterkanton Hegau zählenden Familie von Reischach. Die Gemeinde kam infolge des Vertrags zwischen Württemberg und Baden vom 13. November 1806 an das neugegründeteKönigreich, das sie im Vertrag vom 2. Dezember 1810 tauschweise dem Großherzogtum Baden überließ. Von 1811 bis 1857 gehörte Duchtlingen zum Amt Blumenfeld, von 1857 bis 1936 war die Gemeinde dem Bezirksamt Engen zugeteilt. Auf 1. Oktober 1924 wurde die Gemarkung Hohenkrähen mit der Gemeinde Duchtlingen vereinigt.
1492 stellen Vogt, Richter und gantze Gemaind gemainlich zu Duchtlingen dem Heinrich Duffeli zu Tuttlingen einen Schuldbrief aus und lassen ihn durch Hans Thüring von Friedingen zu Hohenkrähen mit seinem Siegel versehen; auch die Urkunde über eine Kapitalaufnahme von 70 Gulden bei Probst Nikolaus von Öhningen wird 1495 von ihm besiegelt. 1497 siegeln Hans von Reischach zu Engen und Kaspar von Reischach, Burgvogt zu Hohenkrähen, für die Gemeinde.
Die Huldigung von 1811 ist mit einem aufgedrückten ovalen Siegel versehen. Es zeigt einen von einer Rokokokartusche umrahmten gespaltenen Schild, worin eine Pflugschar und eine Sichel. Die Umschrift lautet Gemeind Thuthlingen. In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts wird ein ovales Siegel mit dem badischen Wappenschild mit der Umschrift Vogtey Duechtlingen verwendet. Seit etwa der Jahrhundertmitte erscheint in den Gemeindesiegeln die Sichel im vorderen und die Pflugschar im hinteren Feld des gespaltenen Wappenschildes.
Bei der Prüfung der Siegel und Wappen im Jahr 1910 schlug das Generallandesarchiv vor, nach den alten Siegeln die Pflugschar in das vordere Feld zu nehmen. Der Gemeinderat hat diesem Vorschlag und der Festlegung der Farben im Oktober 1910 zugestimmt.
In Silber auf grünem Dreiberg ein Baum mit schwarzem Stamm, grüner Krone und roten Früchten (Apfelbaum).
Riedheim wurde 1735 von Österreich unter Vorbehalt der Landeshoheit an das Kloster Petershausen verkauft. Die Gemeinde wurde durch den in Hilzingen wohnenden Obervogt des Klosters Petershausen verwaltet. Durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 fiel das Reichsstift Petershausen an Baden. Auch nach der Besitznahme des Petershaus’schen Territoriums durch das Kurfürstentum Baden blieb die Gemeinde Riedheim dem Obervogteiamt (seit 1811: Amt) Hilzingen unterstellt, 1813 wurde die Gemeinde dem Amt Blumenfeld zugeteilt. Nach der Aufhebung des Amts Blumenfeld (1857) befand sich der Amtssitz in Engen. Seit der Auflösung des Amts Engen (1936) zählt Riedheim zum Amtsbezirk bzw. Landkreis Konstanz.
1530 nimmt die Gemeinde Riedheim bei Margarethe von Stad zu Schaffhausen ein Kapital von 120 Gulden auf. Die von Vogt, Dreiern und ganzer Gemeinde ausgestellte Schuldurkunde besiegelt Hans von Schellenberg zu Hüfingen, der auch ein Urteil des Gerichts zu Riedheim von 1538 in einer Streitsache zwischen dem Kloster Stein und Jörg Keller in Riedheim mit seinem Siegel versieht. 1541 schließen die Gemeinde Riedheim und Hans von Schellenberg einen Vertrag wegen einer Zinszahlung. Bilgerin von Reischach hängt dieser Urkunde sein Siegel an. 1678 besiegelt der Landschreiber der Grafschaft Nellenburg einen Erblehensrevers des Hans Jakob Setelin, 1730 besiegelt Johann Baptist Daffinger eine Urkunde über das Widemgut zu Riedheim. Nach einer Aufstellung von 1726bestand zu dieser Zeit die Gemeindeverwaltung von Riedheim aus einem Vogt, drei Bürgermeistern, 9 Gerichtsleuten und 10 Ratmännern.
Der Huldigung von 1811 ist ein Oblatensiegel mit der Umschrift Gemeinde Riedheim beigefügt. Es zeigt einen Laubbaum auf einem Blumenbeet und entspricht in Stil und Ausführung genau dem Siegel von Hilzingen. Vermutlich sind beide Siegel noch zur Zeit der klösterlichen Verwaltung, wohl kurz vor 1800, beschafft worden. Der Laubbaum kehrt stilisiert in einem Farbstempel um 1860 wieder.
1902 schlug das Generallandesarchiv vor, den Laubbaum als „Apfelbaum“ zu bestimmen. Der Gemeinderat vertagte die Zustimmung, hat aber im September 1905 sein Einverständnis erklärt und die vorgeschlagenen Wappenfarben genommen.
In Gold mit Silber-blauem Wolkenbord auf grünem Dreiberg an einem schwarzen Pfahl ein grüner Weinstock mit zwei blauen Trauben.
Fürst Joseph Wilhelm Ernst von Fürstenberg kaufte 1749 von Diepold von Tannberg das Dorf Schlatt am Randen, das bis zum Ende der fürstenbergischen Herrschaft dem Obervogteiamt Engen unterstellt war. Die Gemeinde wurde von Württemberg 1806 in Besitz genommen. In dem Staatsvertrag vom 31. Dezember 1808 zwischen Württemberg und Baden verzichtete das Königreich Württemberg auf alle Hoheitsrechte über Schlatt am Randen. Von 1809 bis 1825 unterstand die Gemeinde dem Amt Blumenfeld, von 1825 bis 1843 befand sich der Amtssitz in Engen, seit 1843 bis 1857 war Schlatt wieder dem Amt Blumenfeld zugeteilt. Nach Aufhebung des Amts Blumenfeld (1857) gehörte Schlatt zum Bezirksamt Engen, se4it 1936 zählt die Gemeinde zum Amtsbezirk bzw. Landkreis Konstanz.
1543 beurkunden Vogt, Gericht unnd ain ganntze Gemaindt gemainlich, Reich und Arm, deß Dorffs zu Schlatt, am Randen gelegen, den Verkauf von Zinsen von dem Schuppenberg zwischen Schlatt und Thayngen. Auf ihre Bitte siegelt Sigmund von Hornstein, Komtur zu Mainau. Ein 1580 von Vogt, Gericht unnd gantzer Gemaindt … des Fleckens Schlatt, am Randen gelegen ausgestellter Zinsbrief ist auf Bitten der Aussteller mit dem Siegel des Grafen Heinrich von Fürstenberg versehen. Der Vogtt und die geschorenen Dreyer und das Gericht, auch ein gantze Gemaind… des Dorffs und Fleckhenß Schlath am Randen stellen 1642 zwei Zinsschreibungen aus und lassen diese durch Hans Spiesecker, Mitglied des Rats zu Schaffhausen, und Graf Wilhelm Heinrich von Fürstenberg besiegeln. 1671 bekennen Vogt, Dreyer und gantze Gemaind Schlatt am Randen die Aufnahme einer Schuld und lassen die Urkunde mit dem Kanzleisekretsiegel der Truchsessen von Waldburg besiegeln. Vogt, Burgermeister oder die Geschworne, auch gantze Gemaind, Reich und Arm, Jung und Alt, niemand ausgeschlossen, deß Fleckens Schlatt a, Randen stellen 1649 und 1650 dem Müller Laurenz Christen zu Thayngen zwei Urkunden aus und bitten Wilhelm Heinrich Truchseß von Waldburg, Balthasar Kalt, Amtmann der Grafschaft Nellenburg, und Hans Jakob Frey, Landschreiber, um ihre Siegel.
Die Huldigung der Einwohner der Gemeinde Schlatt von 1811 ist mit dem aufgedruckten Siegel des Vogtes Johann Hanloser beglaubigt. Es zeigt in von Blumenranken umgebenem Wappenschild die Buchstaben J.H. (=Johann Hanloser). Ein rundes Prägesiegel aus den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Umschrift Gemeinde Schlatt am Randen zeigt einen Schild mit dem badischen Wappen, darüber eine Garbe, rechts eine Sichel und links einen Weinstock. Garbe, Sichel und Weinstock erscheinen nach der Jahrhundertmitte im gekrönten Wappenschild eines Farbstempels, dessen Umschrift lautet Bürgermeisteramt Schlatt a. Randen.
Im August 1902 schlug das Generallandesarchiv der Gemeinde von, in das neu zu schaffende Gemeindewappen den Weinstock aus den alten Gemeindesiegeln zu übernehmen und durch den Fürstenbergischen Wolkenbord au die Zugehörigkeit der Gemeinde zum Territorium der Fürsten von Fürstenberg zu erinnern. Der Gemeinderat hat im August 1902 diesen Vorschlag angenommen. Die Farben des Weinstocks waren, der heraldischen Gepflogenheit der damaligen Zeit entsprechend, mit „natürlich“ angegeben. Da „natürliche“ Farben als unheraldisch vermieden werden sollen und bei einem blau-silbernen Schildbord das Silber entgegen den Regeln der Wappenkunde mit dem Gold des Schildfeldes zusammenstößt, war neuerdings eine Berichtigung des Gemeindewappens nötig. Auf Antrag der Gemeinde ist mit Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 16.07.1960 Nr. IV 31/51 Schlatt a. R./i die Berichtigung der Farben bestätigt worden.
In Gold auf grünem Dreiberg eine grüne Tanne mit schwarzem Stamm.
Weiterdingen bildete mit Bietingen, Hohenstoffeln und Homboll eine Besitzung der zur Reichsritterschaft Hegau zählenden Familie von Hornstein. Infolge des Vertrags zwischen Baden und Württemberg vom 13. November 1806 kam Weiterdingen an das neugebildete Königreich Württemberg, das die Gemeinde 1810 tauschweise dem Großherzogtum Baden überließ. Von 1810 bis 1811war die Gemeinde dem Amt Blumenfeld unterstellt, 1811 bis 1813 war sie dem Amt Stockach zugewiesen. Von 1813 bis 1857 war wiederum Blumenfeld Amtsort. 1857, bei Aufhebung des Amtes Blumenfeld, wurde Weiterdingen dem Bezirksamt Engen zugeteilt. Seit der Auflösung des Amts Engen im Jahr 1936 zählt die Gemeinde zu, Amtsbezirk bzw. Landkreis Konstanz. Auf 1. Oktober 1924 sind die Gemarkungen Homboll und Pfaffwiesen mit der Gemeinde Weiterdingen vereinigt worden.
1540 besiegelten der Obervogt der Herrschaft Hewen Peter Andreas von Altendorf zu Neuhausen und Heinrich Silber, Bürger in Engen, für die Gemeinde Weiterdingen den zwischen Bilgerin von Reischach, den Brüdern Jakob und Pankraz von Stoffeln und den Untertanen zu Weiterdingen und Binningen wegen der Gerichtsbarkeit in diesen beiden Orten abgeschlossenen Vergleich.
Die Urkunde über die am 15. August 1811 abgelegte Huldigung der Einwohner von Weiterdingen ist mit dem Siegel der Stadt Aach beglaubigt, da die Gemeinde über kein eigenes Siegel verfügte. In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts beschaffte die Gemeinde ein ovales Prägesiegel mit der Umschrift Bürgermeisteramt Weiterdingen. Es zeigt auf grasigem Boden eine Tanne. Der Baum erscheint mit leichten Abänderungen auch in den späteren Farbstempeln der Gemeinde.
Auf Vorschlag des Generallandesarchivs hat der Gemeinderat im Oktober 1910 die auf den alten Siegeln nachweisbare Tanne in das neugeschaffene Gemeindewappen übernommen und die Wappenfarben bestimmt.