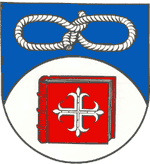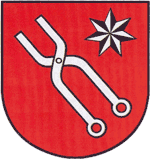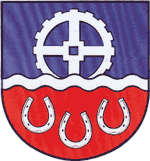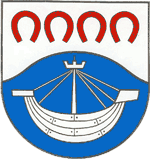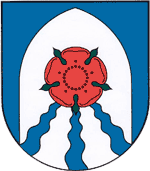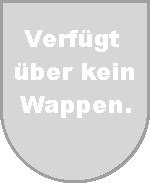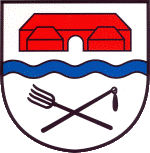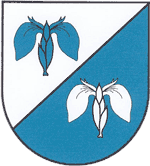Beschreibung der Wappen der amtsangehörigen Kommunen vom
Amt Lütjenburg Gespalten von Silber und Rot. Vorn über zwei blauen Wellen ein roter Leuchtturm mit goldenen Fensteröffnungen in der spitzbedachten, über einer Galerie sich erhebenden Laterne. Hinten über einem schräglinksliegenden goldenen Eichenblatt eine ebensolche Ähre.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Behrensdorf liegt an der Hohwachter Bucht und umschließt den westlichen und nördlichen Teil des Großen Binnensees. Zur Gemeinde gehören neben dem Dorf Behrensdorf die Ortsteile Kembs, Seekamp, Stöfs mit dem ehemaligen Meierhof, das Gut Waterneverstorf sowie der Hafen Lippe mit dem anschließenden Naturschutzgebiet Kleiner Binnensee.
Das Dorf Behrensdorf wird als Bernstorpe erstmalig im Jahre 1433 als zugehörig zum Kirchspiel Lütjenburg erwähnt (UBStL VIII 175). Als selbständige politische Gemeinde existiert sie nach Auflösung des Gutsbezirkes Waterneverstorf seit dem 28.9.1928. Bis zum 30.9.1968 führte sie noch den Namen Waterneverstorf.
Das gespaltene Schild Silber/Rot bezieht sich auf das Wappen der Rantzauer, die einst Besitzer des Gutes Waterneverstorf waren. Der rote Leuchtturm steht für den heute vorhandenen Leuchtturm Behrensdorf. Die blauen Wellenlinien symbolisieren sowohl die Ostsee wie auch den Großen und Kleinen Binnensee.
Die Getreideähre steht für den Haupterwerbszweig der Gemeinde, die Landwirtschaft, das Eichenblatt für die Laubwälder vor allem im Bereich des Ortsteiles Stöfs.
Von Blau auf Silber bogenförmig nach oben geteilt. Oben ein silbernes, zu einer liegenden Acht verschlungenes Seil, unten ein rotes Buch mit silbernem Schnitt und aufgenageltem silbernen Lilienkreuz.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Blekendorf liegt am nordöstlichen Ende des Kreises Plön. Im Norden wird ihre Grenze durch die Ostsee beschrieben, im Westen grenzt sie an die Gemeinden Helmstorf und Hohwacht sowie im Süden an die Gemeinden Högsdorf und Kletkamp.
Das Kirchspiel Blekendorpe wird erstmalig 1259 im registrum capituli des Bistums Lübeck erwähnt (UBL 142). Aus dieser Zeit stammt auch die frühgotische Kirchspielkirche mit dem Patrozinium der Heiligen Clara. Bis zur Auflösung der Gutsbezirke 1927/28 gehörte Blekendorf zum adeligen Gutsbezirk Futterkamp.
Die heutige politische Gemeinde Blekendorf besteht aus insgesamt acht Ortsteilen:
Blekendorf, Futterkamp, Sehlendorf, Sechendorf, Friederikenthal, dem grundbuchlich bis 1901 zum Lübecker Johanniskloster gehörigen Dorf Kaköhl sowie den ehemalig zum Gutsbezirk Kletkamp gehörigen Dörfern Nessendorf und Rathlau.
Das Blekendorfer Wappen zeigt als Figuren unten ein Büchlein, das vor allem im Norden als Attribut der Heiligen Clara gilt (s. K. Künstle, Die Ikongraphie der Heilen, bzw. LCI). Das zur Acht verschlungene Seil steht für den Ortsteil Sehlendorf, das nach A. Schmitz (Die Orts- und Gewässernamen des Kreises Plön, S. 147) soviel bedeutet wie: „Seiler“dorf. Die Bogenteilung steht für den Ortsteil Kaköhl, dessen Name in der Sprachbedeutung soviel heißt wie: Bergkuppe, Hügel (s. A. Schmitz, a. a. O. S. 77).
Von Silber und Blau im Wellenschnitt geteilt. Oben schräg gekreuzt eine rote Axt und ein roter Dreschflegel, unten in fächerartiger Anordnung eine begrannte goldene Gerstenähre zwischen silbernen Eichenblättern.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Dannau besteht seit Auflösung der Gutsbezirke im Jahre 1928 aus den ehemaligen Dörfern zum Gutsbezirk Rantzau gehörenden Dörfern Dannau und Gowens. Das Dort Dannau wird erstmalig 1286 erwähnt (SHRU II Nr. 694), das Dorf Gowens im Jahre 1353 (SHRU IV Nr. 601). Älter als beide Dörfer ist vermutlich jedoch das auf dem heutigen Gemeindegebiet liegende ehemalige Dorf „Gerstenkampe“, dessen Verkauf 1262 beurkundet wird (UBL Nr. 155).
Gerstenkamp ist heute nur noch ein Gehöft.
Der Dreschflegel und die Axt stehen für die historischen Erwerbszweige Acker- und Forstwirtschaft (Gowenser Wald). Die Wellenlinie und der blaue Grund der unteren Hälfte symbolisieren den Dannauer See. Die Eichenblätter wiederum stehen für den Naturraum Wald. Die Gerstenähre steht zum einen für die Kulturlandschaft und zum anderen für die älteste Ansiedlung Gerstenkamp. Die Ähre ist aus diesem Grund als die höchstwertige Figur im Metall Gold gehalten.
In Rot eine schräggestellte, silberne, stilisierte Zange, oben begleitet von einem siebenstrahligen silbernen Stern.
Historische Begründung:
Der Kirchort Giekau war im Mittelalter Sitz der Familie „DE GYCOWE / GHICOWE“, die für die Zeit von 1259 (SHRU 2, 191) bis 1321 (UBBL 1, 494) bezeugt ist. Das von ihr überkommene Siegel zeigt auf stehendem Schilde eine schräg rechts gelegte Zange mit Öhren an den Enden der Handhaben und in der Umschrift zwei sechseckige Sterne (Milde/Masch, Holst. u. Lauenburg. Siegel d. Mittelalters aus d. Archiven der Stadt Lübeck, Heft 1, 1856, Taf. 7 Nr. 89 u. S. 63 Nr. 49).
Dieses alte Siegelbild ist von der Gemeindevertretung als Wappenbild gewählt worden, zumal in der Gemeinde sich ein „Schmiedeberg“ zwischen Giekau und dem Gut Neuhaus, wohl dem alten Adelssitz, befindet und auf das Vorhandensein einer recht alten Schmiede verweist. Sodann besteht die heutige Gemeinde Giekau aus 7 Ortsteilen, für welche die 7 Zacken des Sterns oben links im Wappen stehen. Die Farben sind die des holsteinischen Wappens: Rot und Silber.
Durch einen silbernen Wellenbalken von Blau und Rot geteilt. Oben, durch den Wellenbalken unten überdeckt, ein silbernes Mühlrad, unten drei 2 : 1 gestellte, silberne Hufeisen mit nach oben gekehrten Stollen.
Historische Begründung:
Helmstorf, südlich der Stadt Lütjenburg an der Kossau gelegen, ist allem Anschein nachweisbar als Besitz der Adelsfamilie von Helmerikstorpe. 1275 wird erstmalig der Name eines Riters Godescalcus de Helmerikstorpe genannt (SHRU II, Nr. 492). 1314 war das Gut mit einer größeren Mühle landesherrlich (SHRU IV, Nr. 34). Nach Auflösung des Gutsbezirkes Helmstorf gehören heute die Dörfer Mühlenfeld und Kühren sowie der ehemalige Haupthof Helmstorf zur Gemeinde Helmstorf.
Der silberne Wellenbalken symbolisiert die Kossau, das Mühlrad steht für jene 1314 erwähnte, landesherrliche, bis in die jüngere Vergangenheit erhaltene Wassermühle. Die drei Hufeisen stehen in ihrer Anzahl für die drei Gemeindeteile und das Hufeisen für den historischen und heute noch gültigen Erwerbszweig der Pferdezucht; zudem verweisen die Hufeisen auf die Pferde des in Plön garnisonierten Dragoner-Regiments, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Mühlenfeld weideten.
In Grün unter einem bewurzelten silbernen Eichbaum mit sieben Blättern und zwei roten Eicheln drei goldene Steinkreise in der Stellung 2 : 1.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Högsdorf im Amt Lütjenburg-Land grenzt im Norden an die Gemeinde Blekendorf, im Westen an die Gemeinden Dannau und Helmstorf, im Osten an die Gemeinden Kletkamp und Kirchnüchel sowie im Süden an den Kreis Ostholstein.
Innerhalb des Gemeindegebietes lassen sich zahlreiche vorgeschichtliche Siedlungsbereiche nachweisen.
Högsdorf wird 1367 erstmalig erwähnt (SHRU IV 1229). Bis zur Auflösung der Gutsbezirke 1927/28 gehörte Högsdorf zum Amtsbezirk Adeliges Gut Helmstorf. Die Gemeinde Högsdorf wurde aus dem Dorf Högsdorf, dem Meierhof Flehm sowie einer Enklave des Gutes Neudorf gebildet.
Die Gemeinde Högsdorf ist eine sehr waldreiche Gemeinde (über 200 ha) mit umfangreichen Laubwaldbeständen. Hierfür steht der silberne Eichenbaum.
Die drei Steinkreise stehen für das in Schleswig-Holstein größte eisenzeitliche Urnengräberfeld des Ruser-Steinbusch im nördlichen Bereich der Gemeinde, sie zeigen damit die vorgeschichtliche Bedeutung dieses Siedlungsraumes.
Von Silber und Blau im Wellenschnitt schräglinks geteilt. Oben ein aufgerichteter roter Flußkrebs, unten ein silbernes Mühlrad.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Hohenfelde, Amt Lütjenburg-Land, liegt an der Ostsee zwischen Kolberger Heide und Hohwachter Bucht. Sie grenzt im Westen und im Süden an die Gemeinde Schwartbuck, im Osten an die Gemeinde Panker.
Die heutige Gemeinde Hohenfelde besteht aus dem ehemaligen adeligen Gut Hohenfelde, dessen erste Eigentümer Emeco und Marquardo de Hogenvelde im Kieler Stadtbuch von 1264 – 89 erwähnt werden sowie dem ehemaligen Dorf Syde-Hogenveldt (erste Erwähnung im Lübecker Zehntregister von 1433). Bis zur Auflösung der Gutsbezirke gehörten das Gut an das Dorf zum Amtsbezirk Herrschaft Hessenstein.
Der rote Flußkrebs erinnert an ehemalige Bestände in der Mühlenau, die vom Selenter See in die Ostsee fließt; die Wellenlinie und der blaue Grund an die Ostsee, wie auch die Mühlenau; das Mühlenrad an die historische Kornwassermühle (heute technisches Kulturdenkmal).
In Silber unter vier nebeneinander gestellten, mit den Stollen abwärts weisenden roten Hufeisen ein erhöhter, an den Seiten abflachender blauer Hügel, der mit einem einmastigen, segellosen silbernen Schiff in der Form einer Siegelabbildung belegt ist.
Historische Begründung:
Das Gebiet der Gemeinde Hohwacht liegt an einer nach dem Ort benannten Bucht der Ostsee; westlich grenzt das Gebiet an den Großen Binnensee und die Kossau mit der Gemeindegrenze zur Stadt Lütjenburg, östlich an das Naturschutzgebiet Sehlendorfer See.
Der Name Hohwacht taucht erstmalig in einer Urkunde im Jahr 1557 auf. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde von Hohwacht aus ein reger Handel nach Dänemark betrieben. In den Topographien dieser Zeit wird vor allem die Einfuhr von Pferden sowie die Ausfuhr von Getreide erwähnt.
Nach Auflösung des Gutsbezirkes Neudorf im Jahre 1929 wurden die Dorfschaften Hohwacht, Haßberg und Schmiedendorf sowie das Gut Neudorf zur politischen Gemeinde Hohwacht zusammengeschlossen.
Die vier Hufeisen stehen für die vier Ortsteileder Gemeinde und gleichsam für den historischen Pferdehandel.
Die Bogenlinie beschreibt die äußere Kontur des bronzezeitlichen Grabhügels von Schmiedendorf, einem der größten Grabhügel des Landes Schleswig-Holstein. Hiermit wird auch auf die frühe Siedlungskultur des Bereiches hingewiesen.
Der blaue Grund steht für die angrenzenden Gewässer und die Kogge symbolisiert den historischen Hafen und die von Hohwacht ausgehende Handelsschiffahrt.
In Blau eine nach Art eines gotischen Bogens ausgeschweifte silberne Spitze, belegt mit einer roten heraldischen Rose mit grünen Kelchblättern, von der nach unten fächerartig sich verbreiternd drei blaue Ströme ausgehen.
Historische Begründung:
Kirchnüchel besitzt eine mittelalterliche Kirche in der Nähe einer Quelle, die vermutlich bereits in vorchristlicher Zeit als heilig verehrt wurde, und wo in christlicher Zeit eine Marienkapelle entstand. Die Quelle befindet sich heute in einem Teich des Gutshofes Grünhaus. Sie gibt auch dem Gasthaus „Marienquelle“ in Kirchnüchel den Namen.
Nach der Überlieferung gab es in der Kirche eine als wundertätig verehrte Marienfigur, so daß die Kirche im Mittelalter zu einem Wallfahrtsort wurde. Möglicherweise wurden auch der Quelle Heilkräfte zugeschrieben. Die große Anziehungskraft des Wallfahrtsortes dürfte dann den Landesherrn bewogen haben, dem Ort Kirchnüchel ein Marktrecht zu verleihen. Nicht belegt ist allerdings die Überlieferung, es habe in Kirchnüchel als Zeichen der Marktfreiheit eine Rolandfigur gestanden. Kirchnüchel ist seit 1928 selbständige Gemeinde, eingegliedert in das Amt Lütjenburg-Land, Kreis Plön. Seit 1622 hatte das Dorf zum Gutsbezirk Kletkamp gehört. Das Gut Grünhaus war ursprünglich ein Vorwerk zu Kletkamp. Die Grafen von Brockdorff waren somit auch Patrone der Kirche zu Kirchnüchel. Davon zeugt insbesondere das barocke Mausoleum an der Südseite der Kirche.
Dieser geschichtliche Hintergrund gibt dem kleinen Ort eine vergleichsweise große Bedeutung und hebt ihn aus den Reihen anderer kleiner Orte der Umgebung heraus. Das Wappen soll hierauf Bezug nehmen :
- Der gotische Bogen steht für die Kirche, die ja auch Bestandteil des Ortsnamens ist.
- Die Rose als Mariensymbol weist auf die Schutzpatronin der Kirche und der Wallfahrt hin.
- Die auseinanderlaufenden, sich verbreiternden Wellenbalken versinnbildlichen die Marienquelle, ihre Dreizahl soll gleichzeitig auf mehrere im Gemeindegebiet – aus den Hügeln des Bungsbergs – entspringenden Bachläufe Bezug nehmen, darunter wohl auch die eigentliche Schwentinequelle in einem Quellteich des Hofes Kirchmühl.
- Die Farben Weiß (Silber) und Blau leiten sich von den Wappenfarben des Grafen von Brockdorff her, mit dem Rot der Rose nimmt das Gemeindewappen die Landesfarben auf.
In Rot eine erniedrigte, gefüllte goldene Deichsel, oben belegt mit drei grünen Ähren, die mittlere etwas erniedrigt, unten überdeckt mit elf silbernen Schindeln balkenweise, von denen die beiden äußeren im Schildrand verschwinden.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Klamp im Amt Lütjenburg-Land liegt im Dreieck zwischen den Bundesstraßen B 202 im Norden und B 430 im Osten.
Sie grenzt im Norden an die Stadt Lütjenburg und die Gemeinde Giekau, die auch die West- und Südwestgrenze bildet sowie im Osten an die Gemeinde Helmstorf.
Die Gemeinde führt ihren Namen nach dem 1564 erstmals erwähnten adeligen Gut Klamp, das bis zur Auflösung der Gutsbezirke im Jahre 1928 als Restgut im Amtsbezirk der Herrschaft Hessenstein geführt wurde.
Zur heutigen Gemeinde gehören die Dörfer Vogelsdorf und Wentorf, beide 1433 erstmalig erwähnt (Lübecker Zehntregister S. 46), sowie das Dorf Rönfeldholz.
Die gold gefüllte Deichsel steht für die die östliche Gemeindegrenze bildende Kossau, die in diesem Bereich den Höhenrücken relativ tief einschneidet.
Die balkenartige Reihe der silbernen Schindeln steht sinnsprachlich und -bildlich für das Wort Klamp (= verbindender Steg, Brücke; s. Schmitz, A., Die Orts- und Gewässernamen des Kreises Plön S. 82).
Die drei grünen Ähren symbolisieren die drei Dörfer Vogelsdorf, Rönfeldholz und Wentorf.
In Blau über grün-silbernen Wellen eine durchgehende, torlose silberne Zinnenmauer, mit breitem Zinnenturm, der ein vierpaßförmiges Fenster aufweist und mit zwei auswärts geneigten roten Fähnchen an goldenen Stangen und mit je drei sechsstrahligen goldenen Sternen übereinander besteckt ist; zwischen den Fähnchen ein roter Schild mit silbernem Nesselblatt; beiderseits des Turmes ein sechsstrahliger goldener Stern.
Das Wappen Lütjenburgs beruht auf dem Stadtsiegel von 1353. Mauern und Türme sind im Mittelalter die üblichen Zeichen für die Rechtsstellung als Stadt. Zugleich repräsentieren sie im Lütjenburger Wappen die namengebende Burg, deren Lage bis heute nicht bekannt ist. Doch bestehen begründete Vermutungen, daß die 1163 erstmals erwähnte „Luttelinburch“ mit der älteren slawischen Burg „Liutcha“ identisch ist. Bischof Gerold von Lübeck ließ kurz nach den Wendenkriegen 1156 in „Lutkenborch“ die heutige Michaeliskirche erbauen. Von Graf Gerhard 1. von Holstein 1275 zur Stadt erhoben, entwickelte sich Lütjenburg durch seine verkehrsungünstige Lage ohne Hafen nur langsam zu einem kleinen Marktort für die umliegenden Güter. Ein überliefertes Siegel von 1353 und ein weiteres von 1374 zeigen das bis heute beibehaltene Bildmotiv. Verschiedene Darstellungsformen und Auslegungen haben insbesondere die Fähnchen im Laufe der Jahrhunderte erfahren. Die Sterne sind als Nesselblätter, Kreuzchen oder Rosen interpretiert worden und die Flaggen selbst als Schlüsselbärte oder Federn. Ende des 16. Jh. fehlte der Schildfuß; auch hatte der Turm Fenster und die Mauer Schießscharten und ein Tor. Trotz dieser darstellerischen Unterschiede ist das Wappenbild bis heute im wesentlichen gleich geblieben.
In Blau ein breiter silberner Pfahl, belegt mit einem neugotischen roten Ziegelturm über polygonalem Grundriß mit Fialen oberhalb des Zinnenkranzes, gotischen Fenstern im unteren und kreisförmigen Fenstern in den oberen Geschossen und offenem, übergiebeltem Tor und begleitet beiderseits von drei pfahlweise gestellten, eingebogenen silbernen Rauten.
Historische Begründung:
Die Gemeinde Panker im Amt Lütjenburg-Land, liegt nördlich der Stadt Lütjenburg und der Gemeinde Giekau, im Westen grenzt sie an die Gemeinden Tröndel und Hohenfelde, im Osten an die Gemeinde Behrensdorf, die nördliche Grenze bildet das Ostseeufer.
Die heutige Gemeinde Panker besteht aus sechs ursprünglich zum Gutsbezirk Herrschaft Hessenstein gehörigen Dörfern, die nach Auflösung der Gutsbezirke im Jahre 1928 zu einer Gemeinde zusammengefaßt wurden. Diese Dörfer sind:
Matzwitz, erste Erwähnung im Jahre 1213 (UBStL, T, 14), Gadendorf, erste Erwähnung 1242 (SHRU I, 627), Todendorf, erste Erwähnung 1300 (SHRU II,938), Darry, erste Erwähnung 1345 (UBStL II/2, (41), Satjendorf, erste Erwähnung 1433 (LZR S. 46) und Panker, erste Erwähnung 1433 (LZR, S. 47).
Für den ehemaligen Gutsbezirk Herrschaft Hessenstein steht der 1839 – 41 erbaute bachsteinerne Aussichtsturm auf dem Pilsberg, der zweithöchsten Erhebung des Landes Schleswig-Holstein, der gemeinhin als Hessenstein bezeichnet wird. Die links und rechts zu je drei gestapelten Bogenvierecke stehen in ihrer Anzahl für die sechs zur Gemeinde gehörenden o. g. Dörfer. Die Farben entsprechen den Landesfarben Schleswig-Holsteins.
In Silber ein leicht erhöhter blauer Wellenbalken, oben ein rotes Torhaus, unten schräg gekreuzt eine schwarze Forke und ein schwarzer Dreschflegel.
Das Dorf Schwartbuck gehörte bis 1928 zum Gutsbezirk Panker, das Gut Schmoel, im Eigentum der Hessischen Hausstiftung, ist Teil der Gemeinde. Im oberen Teil des Wappens ist das Torhaus (mit Pforthäusern) des Gutes Schmoel dargestellt. Mit der Darstellung der Mühlenau wird das Wappen geteilt. Die slavische Herkunft des Ortsnamens Schwartbuck ist nicht ganz geklärt. Man vermutet, dass die erste Hälfte des Namens auf das altpolabische svart = Krümmung, Windung zurückgeht, da die Mühlenau mäandernd am Ort vorbeifließt.
Dreschflegel und Mistforke sollen die Schmoeler Leibeigenschaftsprozesse symbolisieren. Bereits 1688 löste der Gutsherr Christoph Rantzau das Schollenband und erklärte die Leibeigenschaft der Bauern und Insten in einem Freibrief für beendet. Seine Nachfolger nahmen diesen Schritt zurück.
1741 klagten die Schwartbucker (und andere) Bauern, um Ihre Entlassung aus der Leibeigenschaft zu erzwingen. Die Klage wurde abgewiesen.
Beim zweiten Prozess kam es 1768 zum Aufruhr der mit Arbeitsgeräten und Stangen bewaffneten Bauern und Insten.
Mit Hilfe des Militärs wurde der Aufstand beendet. 1923 gab es erneut Streit. Die Schwartbucker Bauern versuchten zu beweisen, dass die bisher in Zeitpacht bewirtschafteten Höfe ihr Eigentum geworden waren. Der angestrengte Prozess wurde lange von der KPD unterstützt.
Erst 1930 einigten sich die Bauern mit dem Grundherren und der Siedlungsgesellschaft.
Von Silber und Blau schräglinks geteilt, darin in verwechselten Farben je eine Wasserschwertlilie.
Historische Begründung:
Nicht vorhanden.
Wappenbegründung:
Tröndel gehört zum Amtsbereich des Amtes Lütjenburg-Land. Es ist eine kleine ländliche Gemeinde mit ca. 400 Einwohnern und einer Fläche von 750 ha. Im Osten grenzt sie an die „Stretzer Berge“ (Pilsberg, zweithöchste Erhebung in Schleswig-Holstein und Aussichtsturm Hessenstein) und damit an die Gemeinde Panker, die sich auch im Norden um Tröndel erstreckt. Im Süden liegt die Gemeinde Giekau und im Wessten die Gemeinde Köhn.
In der Gemeinde Tröndel liegen die Ortschaften Emkendorf und Gleschendorf. Die leichte Anhöhe zwischen diesen beiden Orten, genannt Tröndel, stammt aus dem niederdeutschen von „Trünnel“ = die Scheibe, und war der Namensgeber der Gemeinde. Die Gemeinde wurde erst 1929 im Zuge der Auflösung der alten Gutsbezirke geschaffen.
Heute wird die Fläche der Gemeinde fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Erwähnenswertes Handwerk hat es nicht gegeben, auch andere Betriebe / Handel oder eine Kirche sind in der Gemeinde nicht vorhanden gewesen. In den Ausläufern der Endmoränen wird seit Jahren Kies abgebaut. Nördlich und westlich von Emkendorf sowie nördlich von Gleschendorf befindet sich Feuchtgrünland mit der dominanten Wasserschwertlilie. Die Weddelbek, ein kleiner Bach, teilt die Gemeinde in etwa zwei gleich große Gebiete.