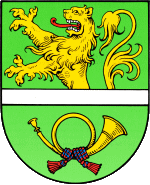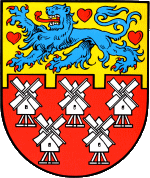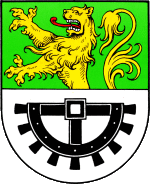In Grün über silberner Leiste ein wachsender goldener Löwe, unten ein goldenes Posthorn mit einer Fessel in den Farben Rot und Blau.
Die Gemeinde Engensen hat bis in das 17. Jahrhundert mit acht anderen Gemeinden des Kreises Burgdorf gemeinsam die Freiengerichtsbarkeit ausgeübt. Aus diesem Grunde wurde der Löwe im oberen Feld gewählt, der in gleicher Ausführung schon in den Wappen der Gemeinden Wettmar, Otze, Thönse und Ramlingen-Ehlershausen erscheint.
Das silberne Band erinnert daran, daß früher die Postverbindung von Celle nach Hannover durch Engensen führte. In Engensen befand sich eine Relais- Station, und die Einwohner waren im Notfall verpflichtet, den Postwagen Vorspann- und sonstige Hilfe zu leisten.
Aus diesem Grunde wurde das Posthorn in das Wappen aufgenommen.
Entwurf: Gustav VölkerGenehmigung durch den Regierungspräsidenten in Lüneburg am 22.4.1960 erteilt.
In Grün ein silbernes Zehnender-Geweih mit Grind, darüber ein goldener Schlüssel mit rechtsgerichtetem Bart.
Fuhrberg an dem großen Wietzer Bruche ist ehemals einer der Grenzorte des hildesheimischen Gaues Flutwidde gegen den mindenschen Loingau gewesen. Der Ort gehörte zum Kirchspiel und zum Amt Großburgwedel, er gehört auch heute noch mit seinen 4297 ha zum Gericht Großburgwedel.
Der Ortsname ist bisher nicht klar gedeutet worden, die ersten Schreibweisen „Wurberghen“ 1323 und „Fuhrberge“ 1377 haben nur im Grundwort einen Hinweis auf einen bestimmten Punkt (berg) im Gelände, doch was „wuhr“ oder „fuhr“ bedeuten soll, ist nicht zu sagen.
Über die Frühzeit dieser nach Uetze zweitgrößten Siedlung im Landkreis Burgdorf bleibt tiefes Dunkel gebreitet, denn die erste Urkunde aus 1323 berichtet nur, daß Hugo und Johannes von Escherde mit Einverständnis ihrer Erben dem Walsroder Propst Heinrich für 20,-- Mark Bremischen Silbers und Gewichtes ihr Landgut (villa in Wurberghen) verkauften. Was vorher war, ist nicht zu erhellen gewesen und bleibt der Phantasie überlassen.
Leider sind auch später nur spärliche, mehr zufällige Nachrichten über Fuhrberg gegeben, die nichts Wesentliches über das Leben der Ahnen aussagen. So hat das 1377 auf gestellte Verzeichnis über den Schaden, den die Leute des Herzogs Otto von Braunschweig dem Herzog Albrecht von Sachsen und Lüneburg sowie dessen Untertanen während der Sühne und des Friedens zufügten, auch von Räubereien „Tho deme Yuhrberge“ berichtet.
Die geographische Lage weitab von Burgdorf und Celle mag den Ort vor weiteren verheerenden Schäden in den bewegten Zeiten des Mittelalters bewahrt haben; die Chronisten, die über den Lüneburger Erbfolgekrieg und den Dreißigjährigen Krieg berichteten, haben Fuhrberg nicht besonders erwähnt.
Erst aus 1768 kommt neue Kunde: Die Gemeinde beschloß, für die alte, baufällige Kapelle eine neue zu bauen. Am 1. Advent 1769 wurde sie geweiht und der erste Gottesdienst in der ersten Fachwerkkapelle mitten im Dorf gehalten, die noch heute besteht.
Maneke (11/304) hat schon 1854 die ansehnlichen Forsten der Amtsvogtei Großburgwedel der Landesherrschaft zugeschrieben und Fuhrberg als Sitz eines Oberförsters (Forstmeister) der Inspektion Lüneburg/Munzel herausgehoben. Sonst hat er nur 43 pflichtige Hausstellen, ein Schulhaus und eine Kapelle erwähnt, vor dem Dorfe eine herrschaftliche Erbenzins-Windmühle, eine Mahlmühle unfern dem Dorfe und eine Wassermühle an der Wietze, die an die Amtsvogtei Bissendorf zinspflichtig war. Sie sind verschwunden.
Bis zum Jahre 1939 war die Einwohnerschaft auf 707 Seelen angewachsen. 1952 ergab die Zählung mehr als das Doppelte durch den Zustrom der Heimatvertriebenen, insgesamt 1476 Einwohner.
Die geschichtlichen Fakten besagen, daß Fuhrberg, zum alten Herzogtum Sachsen gehörig, früher ein Gut besaß, das die Herren von Escherde an das Kloster Walsrode verkauften. Ob es bereits z.Zt. Heinrichs des Löwen existierte und aus der Hand der Welfenherzöge an das Adelsgeschlecht gegeben worden war, ist nicht bekannt. Es ist zu vermuten, daß um diesen Edelhof die Siedlung Fuhrberg entstanden sein wird, wie es für viele Orte aus der Zeit der Landnahme durch die Sachsen seit dem 5. und 6. Jahrhundert bezeugt worden ist. Die Lüneburger Herzoge sind hier Oberherren bis 1866 gebheben, der große Forstbesitz hat dem Ort eine besondere Beziehung zum Herzogshause auch durch die Jagden gegeben.
Auf der geschichtlichen Grundlage hat der Heraldiker seine Entwürfe aufgebaut, die er dem Rat zur Beratung und Beschlußfassung im September 1963 einreichte. Im Vorjahre hatte sich der Rat eingehender mit dieser Sache befaßt, sie dann aber doch zurückgestellt und sie nun endgültig in der Sitzung am 9. Juni 1966 abgeschlossen.
Allein die geschichtliche Tatsache, daß die Herren von Escherde, die vor 1323 in Fuhrberg Gutsherren - wahrscheinlich auch Gerichts- und Zehntherren - waren und ihren Besitz dem Kloster Walsrode verkauften, überzeugte den Rat und bekam den Vorrang, als der Heraldiker im persönlichen Vortrag seine Gedanken zur Sache bekanntgegeben hatte. Diese geschichtlichen Fakten sind nicht umzustürzen und wurden als beste Grundlage für ein neues Wappen akzeptiert.
Damit wurde der goldene Schlüssel als einer der beiden aus dem Wappen der Herren von Escherde im neuen Ortswappen beschlossen und damit das Geschlecht, das in der ersten Urkunde über Fuhrberg 1325 mit dem Ort genannt worden ist, entsprechend geehrt.
Fuhrberg bekommt damit ein ausdrucksstarkes Wappen, das sich recht gut in die Serie der schon vorhandenen Gemeindewappen im Landkreis Burgdorf einfügen wird.
Die Annahme des Wappens ist einstimmig beschlossen worden.
Entwurf: Alfred Brecht
Genehmigung durch den Regierungspräsidenten in Lüneburg am 4.8.1966 erteilt.
Durch Zinnenschnitt geteilt, oben in Gold mit drei roten Herzen, ein schreitender, rotbewehrter, blauer Löwe. Unten in Rot fünf silberne Windmühlen in der Stellung 3:2.
Großburgwedel war jahrhundertelang Zubehör und zeitweise Mittelpunkt der Grafschaft Burgwedel, einer Freigrafschaft, die als Vorläuferin der späteren Amtsvogtei Burgwedel aufzufassen ist und bis ins 19. Jahrhundert hinein für die freien Bauern dieses Gebietes gewisse Sonderrechte festgehalten hat (vgl. Engelke, Die Grafschaft und spätere Amtsvogtei Burgwedel, Hannoversche Geschichtsblätter 26, 1923, S. 1-16). Als Zeichen der Freigrafschaft ist, ähnlich wie bei den 14 Gemeinden des „Großen Freien“ im Südteil des Kreises Burgdorf, ein Löwe in das Wappen übernommen.
Nach Maneke, Beschreibungen der Städte, Ämter und Gerichte im Fürstentum Lüneburg, Celle 1858, II 303, hatte Großburgwedel um 1800 nicht weniger als fünf Windmühlen.
Entwurf: Gustav Völker
Genehmigung durch den Niedersächsischen Minister des Innern am 1.6.1955 erteilt.
In Silber vor einer hohen, fünfzinnigen, roten Wand eine stilisierte, silberne Eiche, wachsend aus dem mittleren von fünf silbernen Steinen. Im grünen Schildfuß eine liegende, silberne Wolfsangel.
Die rote Mauer erinnert daran, daß in Kleinburgwedel früher eine Burg vorhanden war, die 1521 in der Hildesheimer Stiftsfehde zerstört wurde. Die Reste des Burgwalles mit dreizehn großen Findlingen und starken Eichen sind bis 1870 erhalten geblieben. Deshalb wurden die fünf Steine und der Eichbaum in das Wappen aufgenommen. Die Wolfsangel soll die Zugehörigkeit der Gemeinde zum Landkreis Burgdorf symbohsieren, der ebenfalls dieses Zeichen in seinem Wappen führt.
Entwurf: Gustav Völker
Genehmigung durch den Regierungspräsidenten in Lüneburg am 9.12.1959 erteilt.
In Blau vor goldenem Bienenkorb zwei gekreuzte, silberne Imkerbeile, darüber eine rechtshin streichende, golden bewehrte, silberne Gabelweihe.
Es ist nachgewiesen, daß in der kleinen Gemeinde Oldhorst von jeher die Imkerei als besonderer Erwerbszweig der Landwirtschaft eine große Rolle gespielt hat. Deshalb zeigt das Wappen einen Bienenkorb und die Imkerbeile, die alten Zunftzeichen der Imker.
Die im Wappen dargestellte Gabelweihe - auch Roter Milan genannt - soll für alle Zeiten daran erinnern, daß dieser jetzt noch größte Raubvogel unserer engeren Heimat, der durch fortschreitende Kultivierung der Wald— und Moorlandschaft immer mehr zurückgedrängt wird und auszusterben droht, noch heute im Raum der Gemeinde Oldhorst horstet.
Entwurf: Alfred Brecht
Genehmigung durch den Regierungspräsidenten in Lüneburg am 25.7.1965 erteilt.
Von Grün und Silber geteilt, oben ein wachsender goldener Löwe, unten zwei goldene Stiergehörne mit schwarzen Stirnhaaren übereinander.
Der Löwe im oberen Wappenfeld versinnbildlicht die frühere Gerichtsbarkeit der Freien, die die Gemeinde Thönse gemeinsam mit acht anderen umliegenden Gemeinden früher ausgeübt hat. Wir finden den gleichen Löwen bereits in den Wappen der Gemeinden Otze und Wettmar.
Die beiden Stiergehörne erinnern daran, daß in Thönse früher eine besondere Art der Bullenkörung, das sogenannte Bullenstoßen, regelmäßig durchgeführt wurde.
Entwurf; Gustav Völker
Genehmigung durch den Regierungspräsidenten in Lüneburg am 26.6.1959 erteilt.
Geteilt von Grün und Silber. Oben ein wachsender, goldener Löwe, unten die untere Hälfte eines schwarzen Mühlrades.
Der wachsende Löwe weist auf die Freiengerichtsbarkeit, die Wettmar einst besessen hat, hin und das halbe Mühlrad auf die früher in Gemeindebesitz gewesene Wellmühle und die mit „Well-“ gebildeten Flurnamen wie: „In der Welle“, „Im Wellbroke“, „Auf der Wellwisch“, „Auf dem Wellmoor“.
Entwurf: Gustav Völker
Genehmigung durch den Niedersächsischen Minister des Innern am 22.10.1957 erteilt.