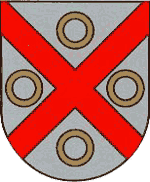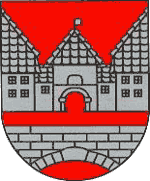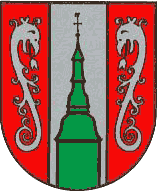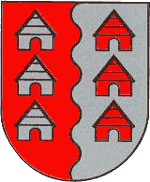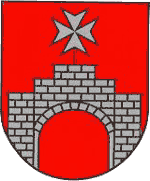Auf silbernem Grund eine sechszackiger roter Stern unter einem Turnierkragen.
Der Zusammenschluss der ehemaligen selbstständigen Gemeinden Alfhausen, Heeke, Thiene und Wallen zur Einheitsgemeinde Alfhausen ist im Jahre 1971 erfolgt. Das Gemeindewappen entspricht dem ehemaligen Wappen der Herren von Bruchhausen und wurde 1985 verliehen.
Unter Turnierkragen (englisch: label!) versteht man ein Unterscheidungszeichen in Form einer aufgelegten Leiste. Auf Wappen wird er als sogenanntes Beizeichen verwendet. In England führt noch heute der Prince of Wales einen silbernen Turnierkragen im Wappen des Königshauses.
Die Bedeutung des Sterns konnte nicht geklärt werden.
Das Wappen der Gemeinde Ankum - zugleich auch der Familie Ankum - zeigt auf silbernem Grund ein rotes Andreaskreuz und in den Winkeln je einen goldenen Ring.
Das Wappen fand sich auf einer Ehrenurkunde aus dem Jahre 1905. Im Schriftverkehr der Gemeinde wurde es erst nach dem Ende des 2. Weltkrieges verwendet. Dazu war das Einverständnis der Familie von Ankum erforderlich. Diese Familie bekleidete führende Stellungen in Osnabrück. Ihr Wappen befand sich am Portal des Hauses Hakenstraße 8, das zum Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts lebten die von Ankums in Ostfriesland, von wo sie nach Danzig und später nach Ostpreußen auswanderten. 1961 erteilte die Familie, 1964 das Regierungspräsidium der Gemeinde die Genehmigung, das Familienwappen als Gemeindewappen verwenden zu dürfen.
Das Andreaskreuz wird durch zwei gleich lange schräge Balken gebildet. Der Apostel Andreas soll an einem Kreuz dieser Form hingerichtet worden sein. Man findet es häufig als Haus-, Gilden- oder Grenzzeichen - und nicht zuletzt vor Bahnübergängen.
In Rot über einer silbernen Steinbrücke ein silbernes Torhaus mit breitem spitzbedachten und einem silbernen Fähnchen versehenen Mittelbau und je zwei ungleichen Seitenbauten, von denen die beiden größeren durch den Schildrand beschnitten werden.
1956 wurde Bersenbrück das Stadtwappen zusammen mit den Stadtrechten verliehen.
1231 gründete Graf Otto von Ravensberg das Zisterzienserkloster Bersenbrück. Das Wappen zeigt die im Jahre 1700 durch die Äbtissin von Nyvenheim errichtete Klosterpforte. Silber und Rot sind nicht nur die Wappenfarben der Osnabrücker Bischöfe, sondern auch die der Grafen von Ravensberg. Sie zogen im 11. Jahrhundert von Calvelage bei Vechta zum Teutoburger Wald bei Borgholzhausen und benannten sich fortan nach der zwischen Borgholzhausen und Halle gelegenen Ravensburg.
Das Wappenschild der Gemeinde Eggermühlen weist eine schwarz-rote Quadrierung auf. Die schwarzen Viertel werden von einem silbernen Schräglinksfluss durchzogen In den roten Vierteln befindet sich je ein schwarzes Wassermühlrad.
Das erstmals nicht von einem Heraldiker, sondern von dem Diplom-Designer Heinz-Jürgen Homuth aus Hasbergen entworfene Wappen wurde 1984 genehmigt.
Die heutige Gemeinde Eggermühlen besteht aus den vier Ortsteilen und ehemals selbstständigen Gemeinden Basum-Sussum, Beesten, Bockraden und Döthen. Sie werden durch die vier Teile der Quadrierung symbolisiert. Bindeglied aller Ortsteile ist die Egger, die sich als silberner Fluss diagonal durch das Wappen zieht. Die beiden Wasserräder stehen für zwei noch erhaltene Wassermühlen. Die Farbe Rot steht nach der Interpretation des Zeichners für den Sonnenauf- bzw. -untergang, der den Tageslauf der Menschen in dieser landwirtschaftlich geprägten Gemeinde seit altersher bestimmt. Die Farbe Schwarz deutet hin auf die fruchtbaren Böden Eggermühlens.
In Rot zwei einander zugewandte, silberne, stilisierte Drachen. Dazwischen ein silberner Pfahl; belegt mit einem grünen Turm, der mit einer barocken Haube versehen ist.
1986 wurden die Einwohner Gehrdes aufgerufen, sich an der Gestaltung eines neuen Wappens zu beteiligen. Den endgültigen Entwurf, der 1987 genehmigt wurde, fertigte Otto Burzlaff, Osnabrück.
Das Wappen zeigt als zentrales Motiv den Turm der Gehrder St.-Christophorus-Kirche, die wahrscheinlich von den Herren von Rüsfort vor 1251 (erste urkundliche Erwähnung) gegründet wurde. Die charakteristische Barockhaube wurde 1740 von Meister Schönebaum aus Osnabrück geschaffen und gilt als Wahrzeichen Gehrdes. Mit der Aufnahme der charakteristischen Artländer Drachen soll die Zugehörigkeit der Gemeinde Gehrde zur Kulturlandschaft des Artlandes zum Ausdruck kommen. Die auf das Bistum Osnabrück zurückgehenden Farben Silber und Rot entsprechen denen des Wappens der Samtgemeinde Bersenbrück. Grün schließlich symbolisiert den ländlichen Charakter der Gemeinde.
Von Rot und Silber im Wellenschnitt gespalten, darin in verwechselten Farben sechs (2:2:2) pfahlweise gestellte Bauernhausgiebel mit offenem Deelentor.
Das Wappen der Gemeinde Kettenkamp stammt von dem Heraldiker Ulf-Dietrich Korn und wird seit 1986 geführt.
Das Wappen symbolisiert den Ursprung der Gemeinde Kettenkamp als Streusiedlung von Einzelhöfen zu beiden Seiten des Eggermühlenbachs, der von den Ankumer Bergen nordwärts zur Hase fließt. Erstmals wurde diese Siedlung 1188 als „Kedinchem“ erwähnt. Die bedeutendsten Grundherren waren die Grafen von Calvelage bei Vechta, später von Ravensberg. Ihre Wappenfarben, die mit jenen des Osnabrücker Bischofs identisch sind, fanden 1951 Eingang in das Bersenbrücker Kreiswappen. Mit dem Kreis Bersenbrück gelangte Kettenkamp 1972 zum Landkreis Osnabrück.
In Rot ein offenes silbernes Tor mit aufgestecktem Johanniterkreuz.
Das Wappen der Gemeinde Rieste zeigt das Haupttor der Johanniter Kommende in Lage. Die Gemeinde führt es bereits seit 1959.
Die Geschichte Riestes ist eng mit der Johanniter-Kommende in Lage verbunden. Sie wurde 1245 gestiftet von Graf Otto von Tecklenburg. Der Johanniterorden entwickelte sich aus einem vor dem ersten Kreuzzug in Jerusalem erbauten Hospital, das getragen war von einer Bruderschaft vom HI. Johannes dem Täufer. Die Gründung in Lage zugunsten des Johanniterordens geht zurück auf die Teilnahme etlicher Ritter des Osnabrücker Landes an den Kreuzzügen.